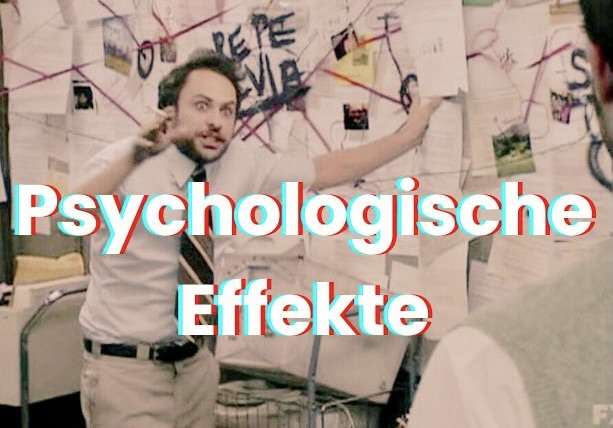November 16, 2025
Letzte Woche haben wir uns zum Beginn dieser Beitragsreihe den Mandela-Effekt angeschaut.
Beitrags-Serie: Von Dunning-Kruger bis Placebo—Die Psychologie hinter bekannten Effekten
Von Dunning-Kruger über Placebo- bis hin zum Backfire-Effekt – Diese Beitragsserie wirft jede Woche einen Blick darauf, wie solche Phänomene…
Im zweiten Teil heute geht es um den Dunning-Kruger-Effekt.
Was ist das?
Definition: Menschen mit geringer Kompetenz überschätzen oft erheblich ihre Fähigkeiten und sind sich weitgehend nicht bewusst, wie unzureichend ihre Fachkenntnisse tatsächlich sind. Sie sind sozusagen ignorant gegenüber der eigenen Ignoranz.
Ursprung: David Dunning & Justin Kruger (1999), Cornell University.
Beispiel: Menschen glauben im Durchschnitt, bessere Leistungen zu erbringen als ihre Kollegen. Das stellte auch Zenger (1992) in einer Umfrage unter mehreren hundert Ingenieuren in zwei Unternehmen fest. Dort zählten sich 32 % der Befragten in dem einem und 42 % im anderen Unternehmen zu den fähigsten 5 % der Mitarbeiter. Man muss kein Mathegenie sein, um zu erkennen, dass das ein statistisch absurdes Ergebnis ist.
Zentraler psychologische Mechanismus:
- Kernmechanismus hinter dem Effekt ist nach Dunning Metaignoranz: Menschen, die über geringe Kenntnisse oder Fertigkeiten in einem Bereich verfügen, fehlt zugleich die metakognitiven Fähigkeiten, ihre eigenen Fehler oder Wissenslücken zu erkennen. Vereinfacht ausgedrückt ist es das Nichtwissen über das eigene Nichtwissen. Diese Ignoranz bleibt aus mehreren Gründen oft unsichtbar:
- Richtiges und falsches Wissen fühlt sich leider exakt gleich an, bis man eines Besseren belehrt wird. Deshalb kann Fehlwissen plausibel erscheinen, etwa bei intuitiver Physik oder falschen Vorstellungen darüber, wie Geräte funktionieren.
- Viele Wissenslücken entstehen außerhalb dessen, woran eine Person überhaupt denkt. Probleme oder Lösungen werden dadurch schlicht nicht erkannt, da sie außerhalb des eigenen Vorstellungsrahmens liegen.
- Top- und Bottom-Performer machen unterschiedliche Fehler in der Selbstbewertung.
- Bottom-Performer überschätzen ihre Fähigkeiten aufgrund mangelnder Einsicht in ihre Fehler, wodurch eine illusorische Überlegenheitswahrnehmung entsteht.
- Top-Performer unterschätzen ihre Fähigkeiten tendenziell, da sie annehmen, dass andere ähnlich gut abschneiden.
- Diese Mangelnde Einsicht in eigene Wissensdefizite bringt gleich mehrere Probleme mit sich:
- Eigenen Leistungen werden nicht realistisch eingeschätzt.
- Es verleitet zu sogenanntem „Reach-around“-Wissen, bei dem allgemeine, oberflächliche oder nur verwandte Kenntnisse fälschlicherweise als ausreichende Kompetenz interpretiert werden.
- Ungesundes Halbwissen verleitet zu Fehlern
- Es entsteht eine „Doppelte Belastung“: Fehlendes Fachwissen führt nicht nur zu Fehlern, sondern verhindert auch, diese Fehler zu erkennen oder die Kompetenz Anderer korrekt einzuschätzen.
- Ignoranz ist weit verbreitet und betrifft nicht nur spezielle Fachgebiete, sondern auch grundlegendes Wissen in Naturwissenschaften, Geschichte oder Politik – mit konkreten Auswirkungen auf alltägliche Entscheidungen, etwa in Bezug auf die eigene Gesundheit oder finanzielle Angelegenheiten.
- Die gute Nachricht: Mit wachsender Expertise verbessert sich die Fähigkeit zur Selbstbewertung. Experten schätzen ihre Grenzen dadurch realistischer ein.
Kurz: Dunning zeigt, dass Unwissenheit nicht nur häufig ist, sondern oft verborgen bleibt, da Menschen oft nicht erkennen wo ihr Wissen endet. Das kann zu Fehlern führen und somit zu einem ein Problem mit praktischen Folgen für individuelle Entscheidungen und gesellschaftliche Prozesse werden.
Kritik am Model:
Einige Kritiker sehen den Dunning–Kruger-Effekt als Ergebnis statistischer Einflüsse oder methodischer Fehler und nicht als psychologisches Phänomen. Dunning betont jedoch, dass der Effekt auch dann bestehen bleibt, wenn solche Faktoren berücksichtigt werden. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte – metakognitive Defizite spielen eine Rolle aber statistische und methodische und Einflüsse können das Muster stärker erscheinen lassen, als es tatsächlich ist.
Zudem spielt auch die größere Fehleranfälligkeit von Low-Performern eine Rolle, da sie schlicht mehr Chancen haben, sich selbst falsch einzuschätzen. Insgesamt bleibt der Effekt bestehen, ist jedoch komplexer und weniger eindeutig, als populäre Darstellungen vermuten lassen.
Antidotes:
- Gezielt Wissen aufbauen: Je mehr solides Fachwissen man hat, desto besser kann man seine eigenen Grenzen erkennen. Bildung und kontinuierliches Lernen stärken die Fähigkeit zur realistischen Selbsteinschätzung.
- Neugier trainieren: Bewusste Suche nach Themenbereichen und Fragen, über die man nicht viel weiß. Wer regelmäßig den eigenen Denkrahmen erweitert, entdeckt eher vorhandene versteckte Wissenslücken.
- Metakognitive Fähigkeiten entwickeln: Lerne, eigene Denkprozesse zu beobachten in dem man sich z.B. Fragen stellt wie „Wo bin ich sicher?“, „Warum bin ich mir da so sicher?“, „Wo könnte ich daneben liegen?“
- Feedback von Experten einholen: Rückmeldungen von Menschen mit mehr Erfahrung oder Kompetenz im jeweiligen Bereich haben, helfen blinde Flecken aufzuzeigen, die man selbst nicht bemerkt.
- Konstruktive Fehlerkultur pflegen: Fehler als Chance zur Verbesserung sehen, nicht als Makel. Wer aus Fehlern lernt, entwickelt ein präziseres Bild der eigenen Fähigkeiten.
- Intellektuelle Bescheidenheit kultivieren: Sich klar machen, dass niemand alles weiß, und offen bleiben für neue Informationen — selbst wenn sie der eigenen Meinung widersprechen.
Quellen
Dunning, D. (2011). The Dunning–Kruger effect: On being ignorant of one’s own ignorance. In Advances in experimental social psychology (Vol. 44, pp. 247-296). Academic Press.
Gignac, G. E., & Zajenkowski, M. (2020). The Dunning-Kruger effect is (mostly) a statistical artefact: Valid approaches to testing the hypothesis with individual differences data. Intelligence, 80, 101449.
Jansen, R. A., Rafferty, A. N., & Griffiths, T. L. (2021). A rational model of the Dunning–Kruger effect supports insensitivity to evidence in low performers. Nature Human Behaviour, 5(6), 756-763.
McIntosh, R. D., Fowler, E. A., Lyu, T., & Della Sala, S. (2019). Wise up: Clarifying the role of metacognition in the Dunning-Kruger effect. Journal of Experimental Psychology: General, 148(11), 1882.
Schlösser, T., Dunning, D., Johnson, K. L., & Kruger, J. (2013). How unaware are the unskilled? Empirical tests of the “signal extraction” counterexplanation for the Dunning–Kruger effect in self-evaluation of performance. Journal of Economic Psychology, 39, 85-100.
Zenger, T. R. (1992). Why do employers only reward extreme performance? Examining the
relationships among performance, pay, and turnover. Administrative Science Quarterly, 37,
198–219.
Gefällt dir meine Arbeit? Du kannst mich und meinen Blog hier unterstützen: